Reflexionen aus Nairobi: Globale Herausforderungen lassen sich durch globale Zusammenarbeit lösen
Im Dezember 2025 diskutierten Teilnehmende des FA(ST)2Africa Networking Meetings in Nairobi die Weiterentwicklung internationaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit. Vertreterinnen und Vertreter aus Ostafrika und Deutschland tauschten sich darüber aus, wie bestehende Kontakte zu nachhaltigen institutionellen Partnerschaften in Forschung und Lehre ausgebaut werden können – insbesondere in den Bereichen Wasser, Energie und Klima. Die folgenden Aussagen spiegeln ein überwiegend positives Fazit des Treffens und verdeutlichen das Potenzial dialogorientierter, partnerschaftlicher Kooperationen.

Kerstin Pfirrmann - Kulturreferentin, Deutsche Botschaft Nairobi


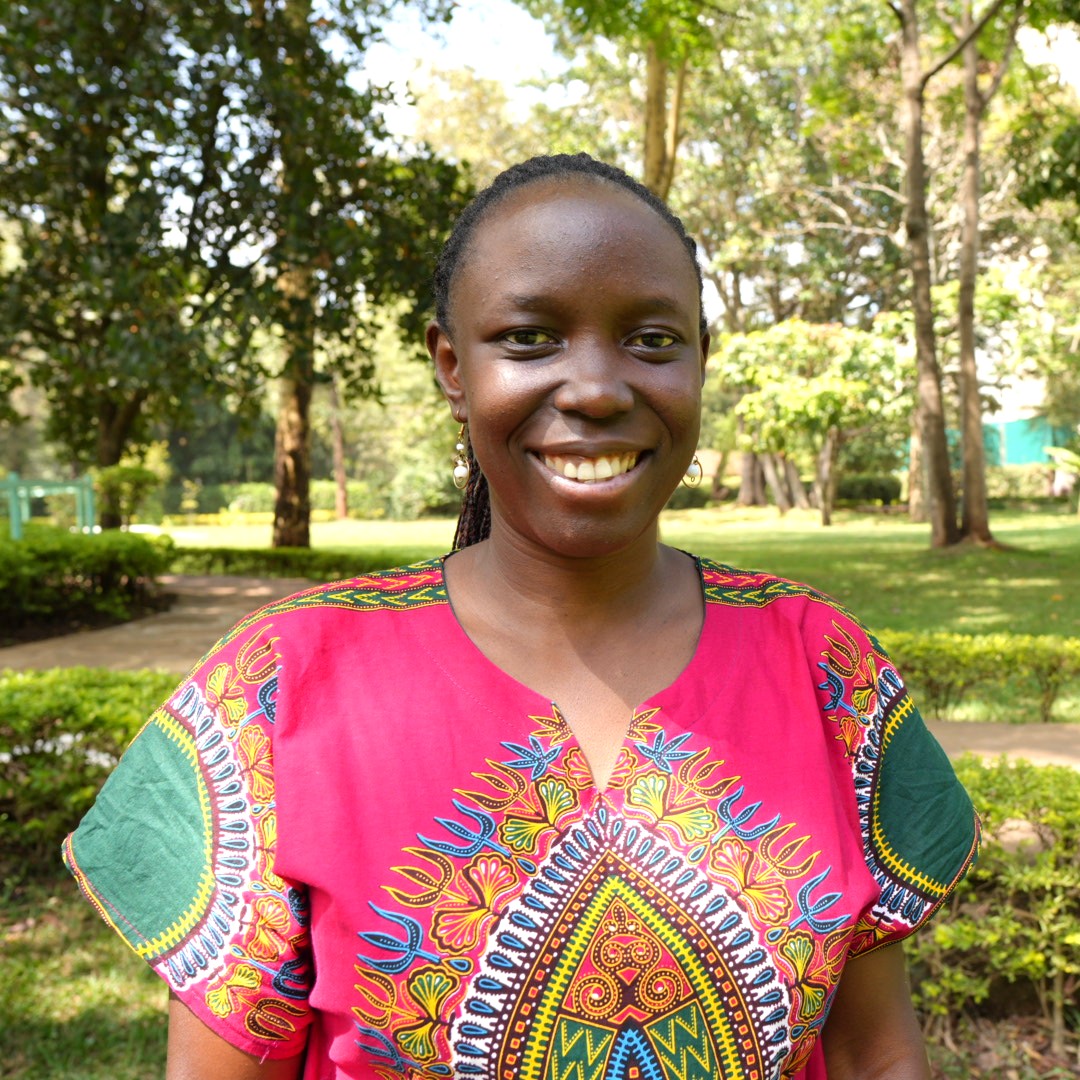



KIT goes Nairobi: Von Vernetzung zur Zusammenarbeit
Wie können wissenschaftliche Kooperationen zwischen Europa und Afrika zukunftsfähig, gleichberechtigt und strategisch weiterentwickelt werden? Mit dieser Frage fand vom 8. bis 10. Dezember 2025 ein weiteres FA(ST)2Africa Networking Meeting in Nairobi statt. Vertreterinnen und Vertreter aus Uganda, Kenia und Äthiopien kamen dort mit einer Delegation des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zusammen, um gemeinsam neue Wege der Zusammenarbeit in Forschung und Lehre zu erkunden. Neben der Projektleitung und dem Koordinator des F2A-Projekts nahmen vom KIT Forschende aus den Themenbereichen Energie, Wasser, Klima und Innovation teil.
Im Zentrum des Treffens stand bewusst ein Dialogformat, das eine vielfältige Interaktion zwischen den afrikanischen Partnern und dem KIT sowie untereinander gab. Statt klassischer Präsentationen lag der Fokus auf Zuhören, Austausch und thematischen Arbeitsgruppen. Die Teilnehmenden aus Ostafrika wurden gezielt ermutigt, ihre Perspektiven, Bedarfe und strategischen Interessen einzubringen. Ziel war es, bestehende Einzelkooperationen besser zu verstehen und gemeinsam zu überlegen, wie daraus tragfähige institutionelle Partnerschaften entstehen können – insbesondere in den Nexus-Bereichen Wasser, Energie und Klima.
„Wir wollten gezielt mit Partnern aus Ostafrika ins Gespräch kommen und gemeinsam überlegen, wie wir die bereits bestehenden Einzelkooperationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am KIT weiterentwickeln können – hin zu einer stärker institutionell verankerten Zusammenarbeit“, sagt Pascale Kohler, Leiterin der Abteilung Internationale Kooperationen und Projekte(ICoP) am KIT und eine der Projektleitungen von FA(ST)2Africa. „Uns ging es dabei auch um die Frage, welche strategischen Richtungen eine mögliche Afrika-Strategie des KIT künftig einnehmen könnte und welche Rolle unsere Partner in Ostafrika dabei spielen.“
Der Ansatz spiegelt einen bewussten Perspektivwechsel wider: Das Networking Meeting war nicht als klassische Konferenz angelegt, sondern als Ideen- und Zuhörformat. Die lokalen Teilnehmenden sollten bewusst mehr sprechen, ihre Erfahrungen teilen und ihre Erwartungen an künftige Kooperationen formulieren. Denn afrikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verfügen über regionale Expertise, Wissen und Innovationskraft, von denen auch deutsche Forschung profitieren kann.
„Unser Ziel ist es, als Institution einen größeren Rahmen zu schaffen – eine Art Umbrella, unter dem themenübergreifende Projekte unterstützt werden können“, so Kohler. „Wenn das KIT vor Ort als Institution auftritt, können wir Kooperationen auf eine neue Ebene heben und unterschiedliche Akteure besser zusammenbringen.“
Gleichzeitig wurde in Nairobi deutlich, dass sich der internationale Wettbewerb um wissenschaftliche Kooperationen mit Afrika intensiviert hat. Andere globale Akteure – etwa China – arbeiten bereits seit Jahren strategisch und langfristig mit afrikanischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen. Vor diesem Hintergrund versteht sich FA(ST)2Africa auch als Impuls, die Rolle Deutschlands in der internationalen Wissenschaftskooperation sichtbarer zu machen, neu zu denken und aktiver zu gestalten.
Neben Universitäten waren in Nairobi auch regionale und kontinentale Netzwerke sowie Vertreter und Vertreterinnen von Förder- und Forschungsorganisationen eingebunden. In den Arbeitsgruppen wurden nicht nur wissenschaftliche Themen diskutiert, sondern auch Fragen zu institutionellen Rahmenbedingungen, Förderlogiken und nachhaltigen Kooperationsmodellen. Deutlich wurde dabei der Wunsch vieler afrikanischer Partner, künftig stärker eigene nationale und regionale Förderstrukturen einzubeziehen.
„Vor allem das klare Interesse unserer Partner, über bestehende Einzelkooperationen hinauszugehen und gemeinsam etwas Größeres aufzubauen – auch institutionell – war für mich ein sehr wichtiges Signal“, sagt Kohler.
Die Ergebnisse des Networking Meetings werden nun systematisch aufgearbeitet und bilden eine Grundlage für die nächsten Schritte im Projekt FA(ST)2Africa sowie für Überlegungen zu einer künftigen Afrika-Strategie des KIT. Das Treffen in Nairobi unterstreicht damit den Anspruch des Projekts, wissenschaftliche Zusammenarbeit neu auszurichten: dialogorientiert, partnerschaftlich und auf Augenhöhe.
FA(ST)2Africa Kick-off in Stellenbosch: Gemeinsam forschen für eine nachhaltige Wirkung vor Ort
Vom 6. bis 8. Oktober 2025 trafen sich Vertreterinnen und Vertreter des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und Partnerinstitutionen aus dem südlichen Afrika in Stellenbosch, um gemeinsame Forschungsschwerpunkte und künftige Kooperationsstrategien zu diskutieren. Das Treffen fand im Rahmen des Projekts FA(ST)2Africa statt, mit dem die internationale Zusammenarbeit des KIT mit afrikanischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen aufgebaut und gestärkt werden soll.
Im Mittelpunkt der Workshops standen die engen Verflechtungen zwischen Wasser, Klima, Ernährung und Energie – Themen, die global, aber besonders in vielen Regionen Afrikas unmittelbar spürbare gesellschaftliche Relevanz haben. In Fachvorträgen, Arbeitsgruppen und Matchmaking-Sessions diskutierten die Teilnehmenden aktuelle Forschungsansätze und entwickelten Ideen für zukünftige Kooperationen. Vertreterinnen und Vertreter der National Research Foundation (NRF), des DAAD Johannesburg und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) präsentierten zudem Fördermöglichkeiten und gaben Einblicke in bestehende Programme.
„Das waren sehr offene Gespräche, aus denen wir viele Erkenntnisse mitnehmen konnten“, sagt Dr. Klaus Rümmele, Leiter der Dienstleistungseinheit Internationales am KIT. Besonders deutlich sei geworden, wie zentral die Wirkung von Forschung vor Ort für die afrikanischen Partner sei. „Eine ganz zentrale Lehre war für mich, dass der Begriff des Local Impact für unsere Partnerinstitutionen von großer Bedeutung ist.“ Forschung solle nicht nur global anschlussfähig sein, sondern auch konkrete Verbesserungen für lokale Gesellschaften und Wirtschaftsstrukturen schaffen – etwa indem sie Beschäftigung, Ausbildungschancen und Innovationen in regionalen Ökosystemen fördert.
Gleichzeitig betonten die Teilnehmenden den Wert echter Partnerschaftlichkeit. „Wir kommen aus einem kolonialen Kontext, in dem europäische Institutionen oft dachten, sie müssten die Welt erklären. Heute wissen wir: Nur gemeinsam können wir globale Herausforderungen wirklich lösen“, so Rümmele. Die Offenheit und gegenseitige Wertschätzung hätten das Treffen geprägt – und Vertrauen geschaffen, das Grundlage für nachhaltige Kooperation ist.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis betrifft die zukünftige Gestaltung von Kooperationen: Das KIT versteht sich nicht nur als Forschungseinrichtung vor Ort, sondern auch als Vermittler in ein breiteres Netzwerk. „Wenn wir als KIT nach Afrika gehen, bringen wir nicht nur unsere eigene Expertise mit“, betont Rümmele. „Wir können auch Kontakte zu anderen baden-württembergischen Universitäten herstellen – etwa auf dem Gebiet der Agrarforschung, die für viele afrikanische Partner besonders relevant ist.“
Auch Mobilität und Austausch stehen im Fokus: Zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äußerten großes Interesse an Forschungsaufenthalten in Karlsruhe. Programme wie die International Excellence Fellowships oder die Innovation Campus Mobility Grants schaffen hier passende Rahmenbedingungen. Sie ermöglichen, gemeinsame Projekte zu vertiefen, mit exzellenten Infrastrukturen zu arbeiten und Erfahrungen sowie Know-how an die Heimatinstitutionen zurückzutragen.
Die Veranstaltung war eingebettet in die Agenda 2063 der Afrikanischen Union, die als langfristige Entwicklungsvision ein wohlhabendes, geeintes und selbstbestimmtes Afrika anstrebt. Sie verbindet wirtschaftliches Wachstum mit sozialer Gerechtigkeit, Bildung und nachhaltigem Umgang mit natürlichen Ressourcen – Ziele, die eng an die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) anschließen.
„Was mich besonders beeindruckt hat, war die Offenheit und Vernetzung unserer Partner – vor allem vor Ort in Stellenbosch“, resümiert Rümmele. „Das war ein inspirierendes Treffen auf Augenhöhe, das uns gezeigt hat, wie lebendig und vielfältig die afrikanische Wissenschaftslandschaft ist.“
Das Networking Meeting markiert damit einen wichtigen Schritt in der strategischen Afrika-Ausrichtung des KIT. Es legt die Grundlage für langfristige Kooperationen, die wissenschaftliche Exzellenz mit gesellschaftlichem Nutzen verbinden und Impulse für gemeinsame Forschungs- und Transferaktivitäten setzen.
Roundtable Africa: Potentials, challenges and opportunities of education and research partnerships
„Afrika steht an der Schwelle zu einer Bildungs- und Wissenschaftsrevolution, die durch internationale Zusammenarbeit beschleunigt werden kann.“ Unter diesem Leitsatz veranstaltete das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) einen hochkarätig besetzten Roundtable im Triangel Space in Karlsruhe.
Die Veranstaltung brachte Stimmen aus Forschung, Wissenschaftsmanagement und internationaler Zusammenarbeit zusammen, um das enorme Potenzial und die Zukunft fairer Partnerschaften zwischen afrikanischen und deutschen Institutionen zu diskutieren. Fachleute nutzten die Plattform, um Chancen und Herausforderungen internationaler Kooperationen aus verschiedenen Blickwinkeln inmitten globaler Umbrüche zu beleuchten.
Im Zentrum der Diskussion stand die Frage, wie tragfähige Partnerschaften zwischen Afrika und Deutschland den Wandel in Bildung und Wissenschaft effektiv unterstützen können – insbesondere vor dem Hintergrund aktueller politischer und wirtschaftlicher Dynamiken.
Moderiert wurde die Diskussion von Dr. Joerg Helmschrot (Projektkoordinator FA(ST)2Africa und WASANet, KIT Namibia). Zu den Panelist:innen gehörten:
-
Dr. Annika Hampel, Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht, Freiburg
-
Dr. Zegeye Mamo, Leiter des Emerging Cities Lab-Addis Abeba (EiABC-AAU und Bauhaus-Universität)
-
Dr. Chris Funk, Direktor des Climate Hazards Center, UC Santa Barbara
-
Prof. Dr. Christian Borgemeister, Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung (ZEF)
-
Gudrun Chazotte, Leiterin der Stipendienprogramme Afrika, DAAD
Machtungleichgewichte und neue Ansätze
Dr. Zegeye Mamo sprach offen über strukturelle Ungleichgewichte, die viele Partnerschaften zwischen afrikanischen und europäischen Institutionen prägen. Forschungsagenden würden häufig durch europäische Förderlogiken bestimmt, sodass sich afrikanische Einrichtungen anpassen müssten. Es gebe jedoch Fortschritte: „Wir haben mit der Bauhaus-Universität eine Plattform auf Basis gemeinsamer Interessen entwickelt – unabhängig von externen Förderaufrufen.“ Er zeigte sich optimistisch: „Afrika ist die letzte Grenze der Urbanisierung. In den nächsten 25 Jahren werden wir Lebensraum für eine Milliarde Menschen schaffen. Das eröffnet enorme Chancen – auch für deutsche Studierende und Fachkräfte.“ Gleichzeitig warnte er vor überzogenen Erwartungen: Afrikanische Universitäten seien häufig überlastet mit entwicklungspolitischen Aufgaben – sie sollen forschen, lehren und Entwicklung vorantreiben – oft als Voraussetzung für staatliche Mittel.
Dr. Annika Hampel betonte, dass erfolgreiche und faire Partnerschaften mit afrikanischen Institutionen mehr erfordern als gute Absichten. Europäische Akteure müssten interkulturelle Kompetenz und Afrikawissenschaften stärken, sich kritisch mit kolonialen Denkmustern auseinandersetzen und bereit sein, Verantwortung und Entscheidungsmacht zu teilen – bei Themen, Finanzierung und Bewertung. Kooperationen sollten auf Augenhöhe stattfinden: Das bedeute gegenseitigen Kapazitätsaufbau, strukturelle Unterstützung für afrikanische Infrastruktur und echte wissenschaftliche Co-Kreation statt einseitiger Datenerhebung. Eine offene Fehlerkultur und der Mut zum Scheitern seien essenziell, um gemeinsam zu lernen und nachhaltige Strukturen aufzubauen.
Hampel forderte einen erkenntnistheoretischen Wandel: „Afrika war zu oft nur Objekt europäischer Forschung. Wir brauchen Kooperationen, die asymmetrische Wissensstrukturen aufbrechen.“ Am Beispiel des Maria Sibylla Merian Institute for Advanced Studies in Africa (MIASA) zeigte sie auf, wie afrikanische Forschende zunehmend selbst initiativ werden – etwa in der kritischen Analyse europäischer Migrationspolitik. Ihr Fazit: Gleichberechtigte Zusammenarbeit brauche Zeit, Vertrauen und strukturellen Wandel: „Nachhaltige Partnerschaften entstehen nicht durch einzelne Förderzyklen, sondern durch langfristiges, konsequentes Engagement.“
Gudrun Chazotte stellte zentrale Herausforderungen und strategische Ansätze für nachhaltige Bildungskooperationen mit afrikanischen Ländern vor. Die DAAD-Expertin mit über 30 Jahren Erfahrung betonte die Notwendigkeit fairer, interessengeleiteter Partnerschaften. Die Ziele beider Seiten müssten offen benannt und aufeinander abgestimmt werden, um effektiv zusammenzuarbeiten. „Nur wenn beide Seiten ihre Ziele transparent darlegen und partnerschaftlich handeln, entstehen tragfähige Strukturen“, so Chazotte.
Ein besonderes Anliegen ist ihr die Förderung unternehmerischer Fähigkeiten bei Stipendiat:innen. Angesichts hoher Arbeitslosigkeit in vielen afrikanischen Ländern sieht sie in der Förderung von Unternehmertum eine Perspektive für Rückkehrer:innen. Durch gezielte Schulungen sollen sie wirtschaftliche Initiativen starten und so zur Entwicklung ihrer Heimatländer beitragen. „Wenn Rückkehrende mit Know-how und Ersparnissen Unternehmen gründen, können sie zu Kernen wirtschaftlicher Entwicklung werden.“ Chazotte betonte zudem die Rolle der afrikanischen Diaspora – insbesondere über Rücküberweisungen, die oft direkt in Bildungssektoren fließen.
Sie plädierte abschließend für einen Perspektivwechsel: Weg vom Begriff „brain drain“ hin zu „brain circulation“. Durch temporäre Auslandsaufenthalte und Rückkehr werde ein zirkulärer Wissensaustausch möglich – zum Vorteil für Herkunfts- wie Aufnahmeländer. Dafür seien jedoch strukturelle Rahmenbedingungen nötig, die solche Mobilität gezielt fördern.
Neue Realitäten in der afrikanischen Wissenschaft
Prof. Dr. Christian Borgemeister blickte auf 30 Jahre Zusammenarbeit mit afrikanischen Universitäten zurück: „Die Entwicklung ist beeindruckend. Universitäten in Accra und Ibadan haben sich enorm weiterentwickelt.“ Das werfe jedoch neue Fragen auf: „Wenn afrikanische Labore eigenständig Spitzenforschung betreiben, passen sie nicht mehr in klassische Förderlogiken. Europäische Partner geraten unter Rechtfertigungsdruck gegenüber Geldgebern, die sichtbare ‚Entwicklungshilfe‘ erwarten.“
Als Leiter eines Chemielabors in Nairobi erlebte er, wie die wachsende Eigenständigkeit afrikanischer Forschungseinrichtungen zu Spannungen mit europäischen Partnern führte, deren Rollen neu definiert werden mussten. Borgemeister forderte, die traditionelle Nord-Süd-Logik zu überdenken und Förderpolitiken an die Realität anzupassen: Statt paternalistischer Ansätze brauche es Partnerschaften auf Augenhöhe, die Kompetenz und Autonomie afrikanischer Institutionen anerkennen und fördern.
Forschung ist lebensnotwendig
„Wissenschaft muss Leben retten – nicht nur Wissen generieren.“ Mit diesem klaren Appell eröffnete Dr. Chris Funk vom Climate Hazards Center der University of California, Santa Barbara, seinen Beitrag beim FA(ST)2Africa-Roundtable des KIT.
Er betonte, dass einfache ethische und physikalische Prinzipien – wie Mitgefühl oder der Umstand, dass wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann – die Grundlage für effektive Klimakatastrophen-Frühwarnsysteme in einer sich erwärmenden Welt bilden. Diese Systeme sollten globale wissenschaftliche Ressourcen nutzen, um lokale, lebensrettende Entscheidungen zu ermöglichen. Forschung dürfe nicht im Elfenbeinturm verbleiben, sondern müsse gemeinsam mit lokalen Meteorolog:innen, Agrarberater:innen und Medien umgesetzt werden – für rechtzeitige, wirksame Information dort, wo sie gebraucht wird.
Fazit: Systemischer Wandel nötig
Der Roundtable machte deutlich: Die Zusammenarbeit zwischen Afrika und Deutschland steht an einem Wendepunkt. Gute Absichten und Leitlinien reichen nicht aus. Notwendig ist ein tiefgreifender Wandel – in den Strukturen, im Denken und im Umgang miteinander. Echte Partnerschaft entsteht durch langfristiges Engagement, geteilte Verantwortung und die Bereitschaft zur Umverteilung von Macht. Afrikanische Perspektiven müssen nicht nur einbezogen, sondern leitend werden. Wie Dr. Hampel betonte: „Die Zeit der Manifeste ist vorbei. Jetzt braucht es systemischen Wandel – hin zu wirklich wechselseitiger, dekolonisierter und nachhaltiger Kooperation.“ Die Bildungs- und Wissenschaftsrevolution hat begonnen. Entscheidend wird sein, ob sie auf Augenhöhe stattfindet – und wer sie mitgestaltet.








